Fremdfirmenmanagement: Beweislastumkehr
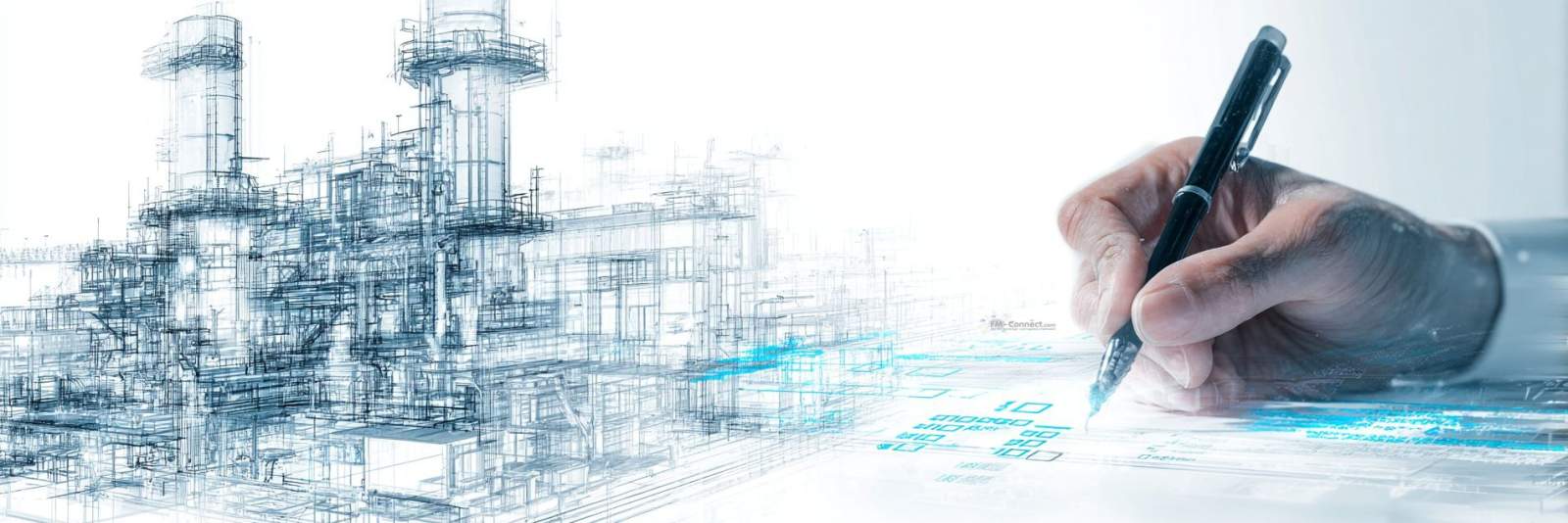
Beweislastumkehr und Entlastungsbeweis im Fremdfirmenmanagement
Im modernen Wirtschaftsleben sind Fremdfirmen (Sub- und Vertragspartnerunternehmen) ein fester Bestandteil von Produktion und Dienstleistung. Ihre Einbindung bringt jedoch besondere Haftungsrisiken mit sich: Kommt es zu Unfällen oder Schäden, stellt sich die Frage, wer zivilrechtlich haftet und wie die Beweislast verteilt ist. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die §§ 831, 823 BGB und die jeweiligen Schutzpflichten der Beteiligten (Auswahl-, Überwachungs- und Instruktionspflichten). § 619a BGB ergänzt diese Regelungen im Arbeitsverhältnis. Öffentlich-rechtliche Vorschriften (insb. ArbSchG und DGUV-Vorschriften) begründen zwar vornehmlich Arbeitsschutzpflichten, haben aber wegen ihrer Bezugnahme auf Sicherungsanforderungen auch zivilrechtliche Relevanz.
Im deutschen Zivilrecht bestimmt § 831 BGB, dass die Haftung des Auftraggebers für Schäden durch Fremdmitarbeiter grundsätzlich vom Vermuten eines eigenen Verschuldens ausgeht. Das hat zur Folge, dass der Verletzte gegenüber dem Auftraggeber kaum Beweise erbringen muss; umgekehrt muss der Auftraggeber den Entlastungsbeweis führen. Im Fremdfirmenmanagement bedeutet dies, dass Auswahl, Unterweisung und Überwachung der Fremdfirma dokumentiert sein müssen, um sie als Entlastungsbeweis vorzulegen. In Großbetrieben kann der Nachweis über die Auswahl und Betreuung der Zwischenkräfte genügen, sofern diese ihrerseits ihre Pflichten erfüllt haben. Erfüllt der Auftraggeber seine Verkehrssicherungspflichten nicht (etwa indem er auf dem Gelände keine Sicherheitsvorkehrungen trifft), kann er wegen Organisationsverschuldens haften. In der Praxis ist es deshalb unabdingbar, ein effektives Fremdfirmenmanagement einzurichten: Neben sorgfältiger Vertragserstellung und Auswahlprozessen zählen dazu regelmäßige Sicherheitsunterweisungen, Kontrollen vor Ort und eine lückenlose Dokumentation aller Maßnahmen. Nur so lässt sich gegenüber Gerichten belegen, dass man „alles Zumutbare getan“ hat.
Es rückt verstärkt die IT-gestützte Dokumentation in den Fokus (z.B. digitale Baustellenakten, elektronische Unterweisungstools), um Beweisaufwand zu reduzieren. Zudem könnten verbandsweite Arbeitsschutzinitiativen oder branchenspezifische Regelungen die Standards weiter anheben. Für den Auftraggeber bleibt letztlich entscheidend, dass er seine kollidierenden Rollen als Vertragspartner und Sicherungspflichtiger klar trennt: Er haftet nicht automatisch für jeden Fremdmitarbeiter-Schaden, muss aber aktiv nachweisen, dass er geeignete Vorkehrungen getroffen hat.
